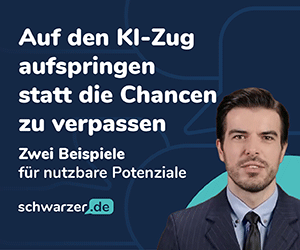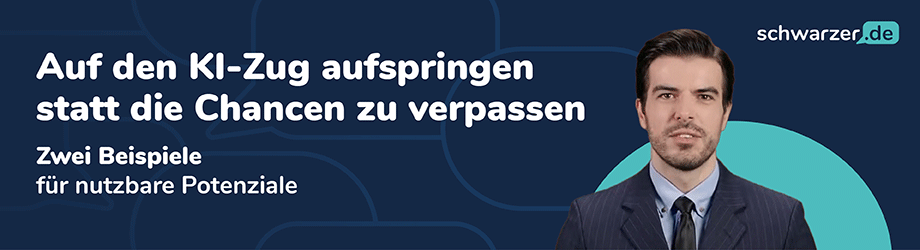Als Erwachsene denken wir manchmal an die Schule zurück und es fällt uns zu den Lehrmethoden häufig nichts anderes ein, als der Frontalunterricht, den wir erlebt und mitunter erlitten haben. Seit den Siebzigern hat sich jedoch so einiges getan.
Jochen Grells Phasenmodell: Ein bewährtes Konzept für effektiven und engagierten Unterricht
Einer der ersten, die Unterricht neu und didaktisch sinnvoller gestalten wollten und dies auch in die Praxis umzusetzen vermochten , war Jochen Grell. Er etablierte ein Phasenmodell für Unterrichtsplanung, das auf den Ergebnissen einer amerikanischen Studie beruht und das man getrost als Anleitung für engagierte Lehrer verstehen kann. Heute arbeiten viele Lehrer nach diesem Modell, weil es sich über die Jahre als sinnvoll und didaktisch effektiv erwiesen hat.
Grells Phasenmodell des Lehrens: Strukturierte Wissensvermittlung mit aktiver Begleitung
Grell geht davon aus, dass man als lehrende Person das richtige zur richtigen Zeit anbieten muss, damit Schüler die Möglichkeit bekommen, erworbenes Wissen schnell in die Praxis umzusetzen und so eine Lernschleife aus Lernen und Machen entsteht. Ein Phasenmodell bedeutet in diesem Zusammenhang Struktur. Dem Lehrer wird so zu sagen eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gegeben, um die didaktische Idee umsetzen zu können, die hinter dem Modell steht.
Grells Methode des Unterrichtens stellt hierbei eine Art Hybrid dar: auf einer gedachten Skala zwischen striktem Frontalunterricht und konstruktivistischem Lernen nach Jean Jaques Rousseau befindet sich Grell in der Mitte. Er setzt auf aktives Lehren und das Begleiten beim Ausprobieren in einer späteren Phase. Es wird also nicht lediglich der Rahmen für Selbsterfahrung gesetzt, sondern die eigenen Erfahrungen des Schülers finden erst nach einem thematischen Input des Lehrers statt und werden von diesem fördernd begleitet. Nachfolgend werde ich die einzelnen Phasen des Lehrens nach Grell beschreiben und erläutern.
Phase 0: Vorbereitung
Es klingt zwar wie eine Binsenweisheit, aber gute Vorbereitung ist für ein Gelingen der Lehrveranstaltung unumgänglich. Es ist dabei unwichtig, ob man einen kurzen Vortrag hält, eine Unterrichtsstunde mit Inhalten zu füllen hat oder ein mehrtägiges Seminar veranstaltet. Nur wer voll im Thema steht ist dazu in der Lage, alle anderen Aspekte des Umgangs mit einer Gruppe von Menschen souverän zu handhaben.
Die Form der Vorbereitung ist dabei sehr individuell: über das unumgängliche thematische Konzept hinaus kann der Lehrer sich beispielsweise einer fixen Dramaturgie bedienen. Manche Menschen ziehen es vor, sich nur grobe Stichpunkte zu notieren oder frei zu agieren.
Man kann sagen, dass die Grenzen, die der Lehrer sich selbst steckt, mit zunehmender Erfahrung immer weniger definiert sein müssen. Gerade Anfänger im didaktischen Bereich sind aber gut beraten, einen genauen Plan zur Hand zu haben. Für alle gilt, dass die Inhalte sitzen müssen – anderenfalls können einen Störungen und unvorhergesehene Geschehnisse aus dem Konzept bringen und man hat keinen Spielraum mehr, auf die Dynamik der Gruppe einzugehen.
Phase 1: Atmosphäre
Wir Menschen lernen am besten und einfachsten, wenn wir uns wohlfühlen. Daher ist es ungeheuer förderlich, wenn es gelingt, eine entspannte und persönliche Atmosphäre zu etablieren. Natürlich ist wichtig, dass die Schüler eine genaue Vorstellung davon haben, mit wem sie es zu tun haben.
Darüber hinaus ist es häufig eine gute Idee, sich beim Einstieg in eine neue Lerneinheit selbst zu positionieren und persönliche Meinungen, Aspekte und Herangehensweisen offenzulegen, wobei dies mit Vorsicht geschehen muss, um die Einstellungen der Schülerschaft nicht unnötig zu manipulieren. Wissensvermittlung funktioniert am besten mit einem persönlichen Bezug. Ebenso ratsam ist es, Transparenz über die Lernziele und den Umfang der Inhalte zu schaffen, damit es den Schülern leichter fällt, sich zu orientieren.
Phase 2: Informierender Unterrichtseinstieg (IU)
Ebenso wichtig, wie die Informationen über die Inhalte und Lernziele der gesamten Lerneinheit kann es gegebenenfalls sein, die einzelne Unterrichtsstunde am Anfang zu strukturieren und klar zu definieren, wohin die Reise gehen soll und was am Ende gelernt worden sein muss. Mit anderen Worten: das Ziel und Stoff der Stunde sollen bekannt sein, um bessere Orientierung möglich zu machen.
Phase 3: Informationsinput
Erst an diesem Punkt setzt im Phasenmodell das ein, was den gesamten Inhalt einer Unterrichtsstunde im Frontalunterricht charakterisiert. An dieser Stelle wird den Schülern das mitgeteilt, was sie zum Lösen der späteren Arbeitsaufgaben brauchen.
In dieser Phase ist es wichtig, die richtige Balance zu finden aus der Gabe des Informationsanteils, der wichtig ist, um konstruktiv arbeiten zu können und dem Zurückhalten von Erkenntnissen, die unwichtig im Zusammenhang sind oder in der eigenen Arbeit ohnehin erworben werden sollen. Hier gilt es, alles mitzuteilen, was nötig ist aber nicht alles was möglich ist!
Phase 4: Anbieten von Lernaufgaben
Verschriftlichte Lernaufgaben stehen im Zentrum dieser Methode. Sie sind der Schlüssel dazu, den Stoff psychologisch und didaktisch sinnvoll zu vermitteln. Lernaufgaben können Einzel-, Zweier-, oder Gruppenaufgaben sein und sind elementare Bausteine im Werkzeugkasten der lehrenden Person. In dieser und der folgenden Phase des Unterrichts geschieht das eigentliche Lernen, das Ausprobieren und das Verinnerlichen des Stoffs.
Phase 5: Selbstständige Arbeit an Lernaufgaben
Diese Einzel- oder Gruppenarbeitsphase ist das Herz der Methode nach Grell. Während Schüler konzentriert arbeiten, steht der Lehrer für individuelle Fragen zur Verfügung, hilft schwächeren Schülern und stellt für alle den kompetenten Ansprechpartner dar. Der große Vorteil ist die Möglichkeit, dort zu helfen, wo geholfen werden muss und die eigenen Ressourcen gezielt und zweckorientiert einsetzen zu können.
Phase 6: Umstellungsphase
Diese Phase dient dazu, die Arbeit am Thema abzuschließen und den Kopf wieder frei zu bekommen. Ein angeordneter Platzwechsel, eine themenbezogene Geschichte oder dergleichen sorgen dafür, dass die Arbeitsphase zu Ende kommt und ein Separator gesetzt wird.
Phase 7: Feedback und Weitererarbeitung
Diese Phase des Unterrichts dient zur Integration des Gelernten in das Skillset der Schüler. Zuerst wird die Möglichkeit geboten, den erarbeiteten Stoff auf Richtigkeit zu prüfen. Der Lehrer gibt Rückmeldung zu den Ergebnissen und macht entsprechende Anmerkungen.
Etwaige Unklarheiten werden besprochen und möglichst aus dem Weg geräumt. Darüber hinaus ist es wichtig, in dieser Phase den Stoff auf Anwendbarkeit zu prüfen und die Inhalte in einen größeren Kontext zu stellen, um Bezugspunkte herauszuarbeiten und Korrelationen darzustellen. In diesem Teil der Unterrichtsstunde werden Transfermöglichkeiten erarbeitet und diskutiert.
Phase 8: Evaluation und Verschiedenes
Während Phase 7 sich mit den Inhalten und dem Stoff beschäftigt, ist Phase 8 dafür gedacht, den Prozess und die Unterrichtssituation selbst zu bewerten und zu reflektieren. Dies kann unter Zuhilfenahme eines Fragebogens geschehen.
Häufig reicht es aber auch, die Schüler nach ihrer Meinung zu fragen, um deren Feedback in die Planung weiteren Unterrichts einfließen zu lassen. Man kann dem Urteil der Schüler hier durchaus vertrauen – sie sind Experten im Lernen und haben häufig ein gutes Gespür dafür, ob eine Methode Sinn ergibt oder nicht.
Dieses Phasenmodell macht Unterricht sehr gut planbar und erleichtert durch die Kombination aus Theorie und Praxis den meisten Schülern das Erschließen des Wissens. Für alle, die darüber nachdenken, dieses Modell einmal zur Anwendung zu bringen gibt es eine grobe Checkliste, für welche Phase man wie viel Zeit einplanen sollte.
- Phase 1: 1-5 min. Ohne Schauspielerei eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen.
- Phase 2: 2-4 min. Was, wie und warum wird gelernt. Informativer Einstieg
- Phase 3: 5-10 min. Wissen und Material für das selbstständige Arbeiten wird zur Verfügung gestellt.
- Phase 4: ca. 5 min. Lernaufgaben werden vorgestellt, Anweisungen gegeben.
- Phase 5: Je nach Zeitbudget. In der Einzel- und Gruppenarbeitsphase kann man sich etwas anderem widmen.
- Phase 6: ca. 2 min. Die Aufmerksamkeit wird wieder auf die gesamte Gruppe gelenkt.
- Phase 7: 5-10 min. Diskussion im Plenum oder ähnliches.
- Phase 8: wenige Minuten zum Rückblick und zur Evaluation.
10 Wichtige Fragen und Antworten zur Unterrichtsplanung in Phasen nach Jochen Grell
1. Was versteht Jochen Grell unter einer „Lernschleife“ im Unterricht?
Grell bezeichnet die Lernschleife als einen fortlaufenden Prozess zwischen Lernen und Machen. Die Idee dahinter ist, dass Schüler theoretisches Wissen nicht nur passiv aufnehmen, sondern es möglichst schnell praktisch anwenden. Dadurch wird das Gelernte gefestigt und kann leichter abgerufen werden. Die Lernschleife basiert darauf, dass Wissen in kleinen, strukturierten Schritten vermittelt wird und daraufhin in realen oder simulierten Situationen zur Anwendung kommt. Diese Methode fördert nachhaltiges Lernen und verhindert eine rein theoretische Wissensvermittlung ohne Bezug zur Praxis.
2. Wie ist das Phasenmodell nach Jochen Grell aufgebaut?
Das Phasenmodell von Grell besteht aus einer strukturierten Abfolge von Unterrichtsphasen, die den Lehrenden eine klare Anleitung zur didaktischen Umsetzung bietet. Die einzelnen Phasen sind:
- 1. Einstiegsphase: Aktivierung von Vorwissen und Motivation der Lernenden.
- 2. Input-Phase: Strukturiertes Lehren durch den Lehrer mit klaren Erklärungen.
- 3. Übungsphase: Erste Anwendung des Wissens unter Anleitung.
- 4. Erprobungsphase: Eigenständiges Ausprobieren in realen oder simulierten Situationen.
- 5. Reflexionsphase: Nachbesprechung und Verknüpfung mit theoretischem Wissen.
Diese Phasen schaffen eine Balance zwischen gelenkter Vermittlung und eigenständigem Lernen.
3. Welche Rolle spielt der Lehrende im Phasenmodell von Grell?
Die Lehrkraft übernimmt eine hybride Rolle zwischen aktivem Lehren und unterstützendem Begleiten. Zu Beginn der Lernschleife gibt der Lehrende klare inhaltliche Vorgaben und leitet durch strukturierte Erklärungen. In den späteren Phasen nimmt er eine begleitende Rolle ein, indem er Schülerinnen und Schüler beim selbstständigen Anwenden ihres Wissens unterstützt, Rückmeldungen gibt und Reflexionen anregt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Lernprozess nicht dem Zufall überlassen wird, sondern gezielt gefördert wird.
4. Worin unterscheidet sich Grells Methode von reinem Frontalunterricht?
Im Gegensatz zum klassischen Frontalunterricht, bei dem Lehrende hauptsächlich Wissen vermitteln und Schüler passiv zuhören, kombiniert Grells Ansatz gezielte Wissensvermittlung mit aktiven Lernprozessen. Zwar gibt es in seinem Modell strukturierte Lehrphasen, aber er setzt auch auf eigenständige Erprobung und Reflexion der Lernenden. Die Schüler erhalten also nicht nur Informationen, sondern lernen durch aktives Anwenden und kritisches Nachdenken, was zu tieferem Verständnis und besserer Behaltensleistung führt.
5. Welche Vorteile hat das Phasenmodell für die Lernenden?
Das Phasenmodell ermöglicht es den Schülern, Wissen systematisch und nachhaltig aufzunehmen. Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:
- Strukturierte Wissensvermittlung: Lernende erhalten eine klare Orientierung und wissen, was sie in jeder Phase erwartet.
- Praktische Anwendung: Sie können das Gelernte direkt ausprobieren, wodurch es besser behalten wird.
- Individuelle Unterstützung: Lehrkräfte begleiten den Lernprozess und können gezielt auf Fragen oder Schwierigkeiten eingehen.
- Reflexion und Transfer: Durch die abschließende Reflexionsphase werden Erkenntnisse mit vorhandenen Wissensstrukturen verknüpft und auf neue Situationen übertragen.
6. Welche didaktische Grundhaltung steckt hinter Grells Ansatz?
Grells Unterrichtsansatz ist eine Mischung aus lehrerzentrierter Wissensvermittlung und konstruktivistischem Lernen. Dies bedeutet, dass er weder reinen Frontalunterricht noch ein völlig offenes Lernmodell bevorzugt. Stattdessen kombiniert er die Vorteile beider Methoden: klare Anleitung und Wissensstruktur auf der einen Seite sowie aktive Selbsttätigkeit und Reflexion auf der anderen. Sein Modell basiert auf der Annahme, dass Lernen am besten funktioniert, wenn es einen Wechsel zwischen Phasen des Instruktionslernens und des eigenständigen Entdeckens gibt.
7. Welche Herausforderungen können bei der Umsetzung des Phasenmodells auftreten?
Bei der praktischen Umsetzung des Modells können verschiedene Herausforderungen auftreten:
- Zeitmanagement: Die einzelnen Phasen müssen gut geplant sein, um den Unterricht nicht zu überfrachten.
- Unterschiedliche Lernvoraussetzungen: Nicht alle Schüler lernen im gleichen Tempo, sodass individuelle Anpassungen nötig sind.
- Widerstand gegen neue Methoden: Manche Schüler sind es gewohnt, passiv zu lernen, und könnten Schwierigkeiten haben, sich auf aktives Lernen einzulassen.
- Didaktische Flexibilität: Lehrkräfte müssen in der Lage sein, zwischen den Phasen flexibel zu wechseln, falls die Lernenden mehr oder weniger Unterstützung benötigen.
8. Wie kann das Phasenmodell in verschiedenen Fächern angewendet werden?
Das Phasenmodell ist vielseitig einsetzbar und kann in verschiedenen Schulfächern angewendet werden:
- Naturwissenschaften: Nach einer theoretischen Einführung (Input-Phase) führen Schüler Experimente durch (Übungs- und Erprobungsphase) und analysieren anschließend ihre Ergebnisse (Reflexionsphase).
- Sprachen: Neue Grammatikregeln werden vorgestellt (Input), dann in Übungen angewandt (Übung), gefolgt von freiem Schreiben oder Sprechen (Erprobung) und abschließender Korrektur (Reflexion).
- Gesellschaftswissenschaften: Nach einer Einführung in ein historisches Thema (Input) erarbeiten Schüler eigenständig Quellenanalysen oder Debatten (Erprobung) und reflektieren anschließend ihre Erkenntnisse.
9. Warum ist die Reflexionsphase besonders wichtig im Phasenmodell?
Die Reflexionsphase ermöglicht es den Lernenden, ihre Erfahrungen mit dem theoretischen Wissen zu verknüpfen. Dadurch können sie erkennen, welche Strategien funktioniert haben, welche Fehler sie gemacht haben und wie sie ihr Wissen in zukünftigen Situationen anwenden können. Ohne Reflexion bleibt das Gelernte oft oberflächlich oder wird nicht langfristig im Gedächtnis verankert. Diese Phase hilft auch dabei, Fehlkonzepte zu korrigieren und den Transfer des Gelernten auf andere Kontexte zu erleichtern.
10. Inwiefern fördert das Phasenmodell von Grell selbstständiges Lernen?
Obwohl das Modell strukturierte Phasen vorgibt, fördert es die Eigenverantwortung der Lernenden. In den späteren Phasen haben die Schüler die Möglichkeit, das Gelernte selbstständig anzuwenden, Lösungswege zu finden und ihre eigenen Erfahrungen zu reflektieren. Der Lehrer dient dabei eher als Mentor und Begleiter, anstatt durchgehend Wissen frontal zu vermitteln. Dieses Vorgehen stärkt nicht nur das Fachwissen, sondern auch die Selbstständigkeit und Problemlösungsfähigkeit der Lernenden.
Das Phasenmodell nach Jochen Grell bietet eine ausgewogene Mischung aus Struktur und Selbsttätigkeit. Es kombiniert die Vorteile traditioneller Unterrichtsmethoden mit modernen, konstruktivistischen Ansätzen und ermöglicht dadurch nachhaltiges und praxisnahes Lernen.
Bildnachweis: © fotolia Titel: contrastwerkstatt, #1: Robert Kneschke, #2: yanlev