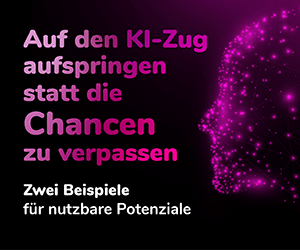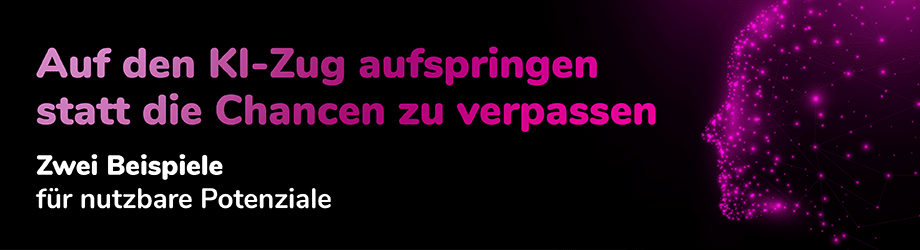Kinder stark machen – das ist die Devise der 2009 bundesweit ins Leben gerufenen Initiative „Ich kann was!“ der Deutschen Telekom. Der Verein möchte Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren helfen, ihre Potenziale zu erkennen, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu entwickeln und so stark für das zukünftige Leben zu machen.
Soziales Kompetenztraining: Chancengleichheit durch gezielte Förderung stärken
Warum ist soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche wichtig?
Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren befinden sich in einer entscheidenden Entwicklungsphase, in der sie wichtige soziale und emotionale Fähigkeiten erlernen. Diese Phase ist geprägt von Persönlichkeitsentwicklung, Gruppenzugehörigkeit und Identitätsfindung. Gleichzeitig kann es in diesem Alter zu sozialen Unsicherheiten, Konflikten und Herausforderungen kommen – insbesondere, wenn Kinder aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen.
Ein gezieltes soziales Kompetenztraining kann dazu beitragen, Chancengleichheit zu fördern und junge Menschen dabei zu unterstützen, ihre kommunikativen, emotionalen und zwischenmenschlichen Fähigkeiten zu stärken.
Was ist soziales Kompetenztraining?
Soziales Kompetenztraining umfasst methodische Übungen und pädagogische Ansätze, die Kindern und Jugendlichen helfen, ihre sozialen Fähigkeiten zu entwickeln und in Alltagssituationen anzuwenden. Dabei geht es unter anderem um:
- ✔ Kommunikationsfähigkeiten: Zuhören, eigene Meinung äußern, Konflikte friedlich lösen.
- ✔ Emotionale Intelligenz: Eigene Gefühle wahrnehmen, regulieren und die Emotionen anderer verstehen.
- ✔ Empathie: Sich in andere hineinversetzen und Mitgefühl entwickeln.
- ✔ Teamfähigkeit: Gemeinsam an Lösungen arbeiten, Verantwortung übernehmen.
- ✔ Selbstbewusstsein und Selbstreflexion: Die eigenen Stärken und Schwächen erkennen und daran wachsen.
Diese Fähigkeiten sind nicht nur für den schulischen und familiären Alltag wichtig, sondern auch für die spätere berufliche und gesellschaftliche Integration.
Warum ist gezielte Förderung wichtig?
In Deutschland bestimmt immer noch häufig die soziale Herkunft über den Bildungserfolg und die Zukunftschancen eines Kindes. Kinder aus finanziell oder sozial benachteiligten Familien haben oft weniger Zugang zu Bildungs- und Förderprogrammen, wodurch sich Chancenungleichheiten bereits früh verfestigen.
Ein gezieltes sozialpädagogisches Kompetenztraining kann diesen Kindern helfen, ihre sozialen und emotionalen Fähigkeiten zu entwickeln und sie auf Herausforderungen im schulischen und privaten Bereich vorzubereiten.
💡 Ziel ist es, allen Kindern – unabhängig von ihrer Herkunft – gleiche Chancen zu bieten, um sich in der Gesellschaft zu entfalten.
Wie kann man soziales Kompetenztraining gestalten?
Ein effektives soziales Kompetenztraining für Kinder und Jugendliche im Alter von neun bis 14 Jahren sollte praxisnah, spielerisch und interaktiv gestaltet sein. Folgende Methoden haben sich bewährt:
1. Rollenspiele und Theaterpädagogik
- Kinder und Jugendliche lernen, sich in andere Rollen hineinzuversetzen.
- Sie üben den Umgang mit Konflikten, schwierigen Situationen und Gruppendynamiken.
- Szenen aus dem Alltag (z. B. Mobbing, Streit, Gruppendruck) werden nachgestellt und gemeinsam reflektiert.
2. Kooperations- und Vertrauensspiele
- Gruppenaufgaben wie „Blinder Weggefährte“ (ein Kind führt ein anderes mit verbundenen Augen) fördern Teamgeist und Vertrauen.
- Kooperative Spiele stärken die Fähigkeit zur Zusammenarbeit und Kommunikation.
3. Kommunikationsübungen
- Übungen wie das „Spiegelgespräch“, bei dem Kinder einander aufmerksam zuhören und sich in die Perspektive des anderen versetzen, fördern aktive Gesprächsführung.
- Diskussionen und Feedback-Runden helfen, die eigene Meinung zu äußern und gleichzeitig andere Sichtweisen zu respektieren.
4. Stärkung der emotionalen Intelligenz
- Kinder lernen durch Emotionskarten oder Gefühlsübungen, ihre eigenen Emotionen zu benennen und auszudrücken.
- Reflexionsrunden helfen, negative Emotionen zu regulieren und konstruktiv damit umzugehen.
5. Konfliktlösung und Deeskalation
- Methoden zur gewaltfreien Kommunikation (z. B. „Ich-Botschaften“) helfen, Konflikte ohne Eskalation zu lösen.
- Kinder entwickeln Lösungsstrategien für Streit und Meinungsverschiedenheiten.
6. Kreative Ausdrucksformen
- Musik, Kunst und Bewegung werden eingesetzt, um Emotionen auszudrücken.
- Gestalterische Aktivitäten fördern Selbstbewusstsein und Identitätsbildung.
Erfolgschancen und langfristige Auswirkungen
Ein gut durchgeführtes soziales Kompetenztraining kann langfristig dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche:
- ✅ Selbstsicherer auftreten und mit herausfordernden Situationen besser umgehen.
- ✅ Bessere zwischenmenschliche Beziehungen aufbauen und sich in Gruppen integrieren können.
- ✅ Respektvoll miteinander umgehen und Konflikte konstruktiv lösen.
- ✅ Schule und spätere berufliche Herausforderungen besser meistern.
Langfristig trägt die Förderung sozialer Kompetenzen dazu bei, gesellschaftliche Ungleichheiten abzubauen und Kindern aus schwierigen Verhältnissen eine echte Zukunftsperspektive zu bieten.
Projekte für Kinder und Jugendliche
Die Anleitung der „Ich kann was!“-Projekte erfolgt durch pädagogische Fachkräfte, die lebensweltorientiert arbeiten. Die Kinder und Jugendlichen sollen im Rahmen dieser Programme die Möglichkeit haben, individuelle Fähigkeiten auszuprobieren und zu vertiefen und soziale Kompetenzen wie Empathiefähigkeit, Einfühlungsvermögen etc. zu erlernen.
Zu den Themen der Projekte zählen Gewalt- und Konfliktvermeidung, der richtige Umgang mit Geld oder auch medien- und kulturpädagogische Aktivitäten. Im Fokus liegt auch der Kompetenzerwerb im Gruppenbereich: so sollen die jungen Menschen lernen, ihre eigenen Gefühle, Ideen und Wünsche auszudrücken, die anderer zu respektieren und auch kleinere Projekte in die Tat umzusetzen.
Die Initiative orientiert sich dabei an den wissenschaftlichen Standards der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die drei Kategorien für ein erfolgreiches Leben nennt (https://www.initiative-ich-kann-was.de/index.php?id=156):
- Kompetenz des selbstständigen Handelns
- Kompetenz, in sozial heterogenen Gruppen erfolgreich zu agieren
- Kompetenz, erfolgreich mit Instrumenten der Kommunikation und des Wissens umzugehen.
Die Initiative handelt nach dem Grundsatz, dass der Kompetenzerwerb spielerisch unterstützt werden kann – so helfen Spiele dabei, verschiedene soziale Kompetenzen zu fördern. So soll das Spiel „Wer bin ich, was liebe ich?“ Kinder befähigen, zum einen ihre eigenen Stärken zu erkennen und diese in Worte zu fassen, zum anderen die Fähigkeiten der Anderen wahrzunehmen.
Dazu setzen sich die Kinder in einen Kreis und notieren auf einem Blatt Papier drei Eigenschaften, die sie an sich selbst toll finden. Diese Zettel werden in der Mitte des Sitzkreises gesammelt und wenn alle fertig sind, werden die Aussagen von der pädagogischen Fachkraft vorgelesen. Die Gruppe versucht nun gemeinsam herauszufinden, um wen es sich handelt.
Video: Kinder sicher und stark machen
Training für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung
Auch das Sozialtraining „Locker bleiben“ möchte Kinder und Jugendlichen mit einer geistigen Behinderung in ihrer sozial-emotionalen Entwicklung fördern. Das Programm wird von eigenständigen pädagogischen Teams an Schulen und Heilpädagogischen Tagesstätten durchgeführt.
Auch sie sind der Ansicht, dass Spiele und Übungen dabei helfen, soziale Kompetenzen bei Kindern und Jugendlichen auszubilden, weswegen sich auf ihrer Homepage (http://www.locker-bleiben-online.de) eine buntgemischte Sammlung zum Thema soziales Lernen findet.
Sehr beliebt bei Kindern sind Luftballonspiele, da diese meist Bewegung und Musik inkludieren. Eine sehr gute Gruppenübung ist es, den Teilnehmern 100 Luftballons, eine Rolle Klebeband, Paketschnur und eine Schere zu geben. Die Aufgabe: Die Gruppe soll gemeinsam überlegen und umsetzen, wie sie aus den Materialen einen Turm bauen kann, der mindestens zehn Sekunden frei steht.
Theaterpädagogische Übungen für die Emotionen
Theaterpädagogische Übungen helfen dabei, Emotionen bewusst wahrzunehmen, auszudrücken und mit anderen zu teilen. Sie eignen sich für verschiedene Altersgruppen und sind besonders wertvoll in Schulen, sozialen Einrichtungen und der therapeutischen Arbeit.
Hier sind 10 ausführliche theaterpädagogische Übungen, die gezielt darauf abzielen, emotionale Ausdruckskraft zu fördern und Empathie sowie Selbstbewusstsein zu stärken.
1. Emotionen-Pantomime
📌 Ziel: Wahrnehmung und Ausdruck von Gefühlen ohne Sprache trainieren.
🔹 Ablauf:
- Jeder Teilnehmer zieht eine Karte mit einer Emotion (z. B. Freude, Wut, Angst, Überraschung, Trauer).
- Die Emotion wird nur durch Körpersprache und Mimik dargestellt.
- Die anderen raten, um welche Emotion es sich handelt.
- Anschließend folgt eine Reflexion: Wie wurde die Emotion dargestellt? Was hat geholfen, sie zu erkennen?
2. Gefühlsstafette
📌 Ziel: Emotionen weitergeben und deren Wirkung erleben.
🔹 Ablauf:
- Die Gruppe steht in einem Kreis.
- Eine Person startet mit einer Emotion (z. B. Angst) und stellt sie mimisch und körpersprachlich dar.
- Der nächste nimmt diese Emotion auf, verstärkt sie und überträgt sie an die nächste Person.
- So geht die Emotion einmal durch den Kreis und verändert sich dabei möglicherweise.
- Reflexion: Wie hat sich die Emotion im Laufe der Übung entwickelt?
3. Gefühlsparkour
📌 Ziel: Körperbewusstsein und emotionale Ausdruckskraft stärken.
🔹 Ablauf:
Im Raum werden verschiedene „Zonen“ geschaffen, die für unterschiedliche Emotionen stehen.
- Beispiel: Eine Ecke für Freude (mit bunten Stoffen), eine für Wut (mit Kissen zum Werfen), eine für Trauer (ruhige Musik).
- Die Teilnehmer bewegen sich durch den Raum und nehmen die jeweilige Emotion an.
- Anschließend Reflexion: Welche Emotion fiel leicht? Welche schwer? Warum?
4. Der Spiegel der Emotionen
📌 Ziel: Empathie und emotionale Ausdrucksfähigkeit trainieren.
🔹 Ablauf:
- Die Teilnehmer arbeiten in Paaren.
- Eine Person stellt eine Emotion dar, die andere spiegelt diese exakt nach (Mimik, Körperhaltung, Bewegung).
- Danach werden die Rollen getauscht.
- Reflexion: Wie hat es sich angefühlt, gespiegelt zu werden? Wie war es, die Emotion eines anderen nachzuempfinden?
5. Der Gefühlswechsel
📌 Ziel: Schnell zwischen Emotionen wechseln können.
🔹 Ablauf:
- Der Spielleiter ruft verschiedene Emotionen auf (z. B. Freude, Angst, Wut, Trauer, Überraschung).
- Die Teilnehmer müssen sofort in diese Emotion gehen und sie mit Stimme, Mimik und Bewegung ausdrücken.
- Variation: Die Emotionen können während einer Szene immer wieder spontan gewechselt werden.
- Reflexion: Welche Emotion fiel besonders schwer? Welche war leicht?
6. Emotionale Statuen
📌 Ziel: Gefühle mit Körperhaltung ausdrücken.
🔹 Ablauf:
- Jeder Teilnehmer bekommt eine Emotion zugewiesen.
- Dann soll er eine statische Körperhaltung einnehmen, die diese Emotion widerspiegelt.
- Die anderen bewegen sich durch den Raum und betrachten die „Statuen“.
- Reflexion: Welche Haltungen waren besonders ausdrucksstark?
7. Gefühle vertauscht
📌 Ziel: Emotionen aus einem neuen Blickwinkel erleben.
🔹 Ablauf:
- Die Gruppe improvisiert eine Szene (z. B. Begrüßung nach langer Zeit).
- Jedes Mal werden die Emotionen verändert: Eine freundliche Begrüßung wird plötzlich wütend, eine traurige Nachricht wird voller Freude erzählt.
- Reflexion: Wie verändert sich die Wirkung der Szene durch den emotionalen Wechsel?
8. Die Gefühlskette
📌 Ziel: Emotionen im Zusammenspiel erleben.
🔹 Ablauf:
- Eine Person beginnt eine kurze Szene mit einer starken Emotion.
- Der nächste übernimmt die Szene, bringt jedoch eine andere Emotion hinein.
- So entwickelt sich eine Kette von Emotionen und neuen Dynamiken.
- Reflexion: Wie beeinflussen sich die Emotionen gegenseitig?
9. Emotionale Geschichten
📌 Ziel: Emotionen in Geschichten einbauen und erleben.
🔹 Ablauf:
- Die Teilnehmer erzählen eine kurze Geschichte.
- Während der Geschichte verändert sich die Emotion ständig (z. B. von Angst zu Freude zu Wut).
- Die Zuhörer reagieren auf diese Emotionen und spiegeln sie wider.
- Reflexion: Welche Emotion hat am stärksten gewirkt?
10. Die unsichtbare Last
📌 Ziel: Emotionen körperlich spüren und darstellen.
🔹 Ablauf:
- Jeder Teilnehmer stellt sich vor, eine unsichtbare emotionale Last zu tragen (z. B. Wut als Stein auf dem Rücken, Trauer als Seil um die Schultern).
- Die Bewegung im Raum verändert sich durch diese Last.
- Danach wird die Last „abgelegt“ – wie fühlt sich das an?
- Reflexion: Wie beeinflussen uns Emotionen körperlich?
Fazit: Soziales Kompetenztraining als Schlüssel zur Chancengleichheit
Soziales Kompetenztraining ist keine Nebensache, sondern eine essenzielle Grundlage für die persönliche und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Gerade in benachteiligten sozialen Umfeldern kann gezielte Förderung dazu beitragen, die Bildungschancen zu verbessern und den Kindern mehr Selbstvertrauen und soziale Sicherheit zu geben.
💡 Wenn wir allen Kindern die Möglichkeit geben, sich sozial und emotional weiterzuentwickeln, schaffen wir nicht nur mehr Gerechtigkeit, sondern auch eine gesündere und stärkere Gesellschaft.
Bildnachweis: © Titelbild: Fotolia-Robert Kneschke